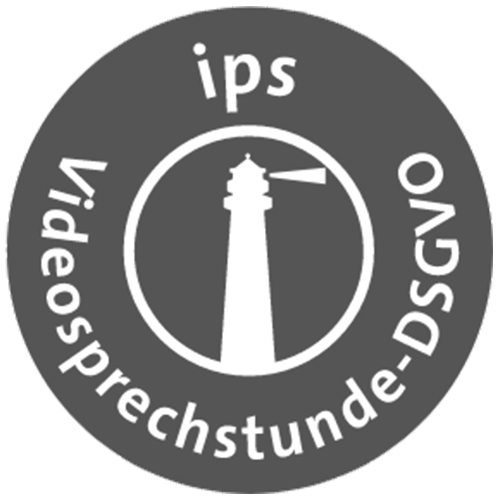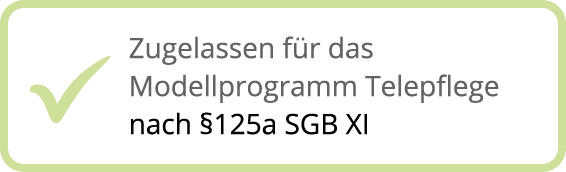Wenn Sie ein:e Psychotherapeut:in ohne Kassensitz sind und eigentlich nur Selbstzahler:innen und Privatversicherte behandeln, dann kennen Sie bestimmt die verzweifelten Anrufe: „Ich bin gesetzlich versichert. Haben Sie einen Therapieplatz für mich?“ Hand aufs Herz: Wie oft haben Sie hier schon mit einem mulmigen Gefühl abgelehnt?
Die Versorgungslage in der ambulanten Psychotherapie ist seit Jahren angespannt. Während die Wartezeiten bei Kindern und Jugendlichen bis zu sechs Wochen, bei Erwachsenen bis zu drei Monate als zumutbar gelten, liegt die Realität oft weit darüber: Durchschnittlich warten Patient:innen 142 Tage vom Erstgespräch bis zum Therapiebeginn, was für viele Betroffene eine unzumutbare Belastung darstellt.
Aus dem privaten Umfeld unserer Kolleg:innen hier bei Consularia ist jemand in genau der Situation, akut einen Psychotherapieplatz zu benötigen. Und trotz unserer guten Kontakte in der Branche ist kein Platz zu finden. Leider ist die Person auch nicht in der Lage, selbst zu zahlen – sie ist auf die Leistung ihrer gesetzlichen Krankenkasse angewiesen. Und sie erlebt das, was die Satiresendung extra3 am 17. Juli 2025 gut aufgespießt hat:
In dieser Situation bietet das Kostenerstattungsverfahren nach § 13 Absatz 3 SGB V einen wichtigen Ausweg. Denn damit sind gesetzliche Krankenkassen verpflichtet, die Kosten für eine Psychotherapie zu übernehmen, auch wenn diese in einer Privatpraxis stattfindet.
Dieser Artikel soll Ihnen als Psychotherapeut:in ohne Kassensitz helfen, gesetzlich versicherten Patient:innen einen Weg zur Therapie aufzuzeigen, der sonst nur Selbstzahler:innen und Privatversicherten offen steht.
Was ist das Kostenerstattungsverfahren?
Das Kostenerstattungsverfahren ermöglicht es gesetzlich Versicherten, sich bei approbierten Psychotherapeut:innen ohne Kassensitz behandeln zu lassen und die Kosten von ihrer Krankenkasse erstattet zu bekommen. Die rechtliche Grundlage ist § 13 Absatz 3 SGB V, der einen Rechtsanspruch auf Kostenerstattung gewährt, wenn die Krankenkasse nicht in der Lage ist, eine unaufschiebbare Leistung rechtzeitig zu erbringen.
Das Bundessozialgericht (BSG Az. 6 RKa 15/97) stellt dazu in einem wichtigen Vergleich klar: Es ist Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen, eine:n Vertragsbehandler:in zur Verfügung zu stellen – nicht Aufgabe der Patient:innen, sich selbst einen Platz zu suchen. Dies unterstreicht die Verantwortung des Systems für eine angemessene Versorgung.
Voraussetzungen für die Kostenerstattung
Für eine erfolgreiche Beantragung müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein:
- Qualifikation der Behandler:innen: Der:die Therapeut:in muss im Facharztregister als fachkundige:r Psychotherapeut:in ausgewiesen sein und die Therapie in einem der anerkannten Richtlinienverfahren ausüben können. Dies umfasst Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und Analytische Psychotherapie.
- Behandlungsnotwendigkeit: Bei der gesetzlich versicherten Person muss eine klinisch relevante psychische Störung mit Krankheitswert vorliegen. Die Behandlung soll zur Heilung führen oder zumindest Beschwerden lindern und eine Verschlimmerung verhindern.
- Systemversagen nachweisen: Patient:innen müssen dokumentieren, dass sie trotz angemessener Bemühungen keinen Therapieplatz bei zugelassenen Therapeut:innen in zumutbarer Zeit und Entfernung finden konnten. Dies erfolgt durch systematische Kontaktaufnahme mit mehreren Kassenpraxen.
Neue Anforderungen seit 2017
Seit der Reform der Psychotherapie-Richtlinie 2017 ist für Patient:innen der Besuch einer psychotherapeutischen Sprechstunde vor Beantragung einer Kostenerstattung verpflichtend. Die psychotherapeutische Sprechstunde dient der frühzeitigen Feststellung, ob ein Verdacht auf eine seelische Krankheit vorliegt und weitere fachliche Hilfe notwendig wird.
Wichtig: Die Einführung der Sprechstunde und Akutbehandlung hat den Rechtsanspruch auf Kostenerstattung nicht eingeschränkt. Krankenkassen dürfen die Kostenerstattung nicht mit Verweis auf diese neuen Leistungen ablehnen, da diese keine ausreichende und abschließende Versorgung im Sinne einer Richtlinien-Psychotherapie darstellen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Die gesetzlich versicherten Patient:innen müssen einen komplexen Prozess durchlaufen, bevor ihre jeweilige Krankenkasse die Kostenübernahme genehmigt.
Schritt 1: Psychotherapeutische Sprechstunde
Der:die gesetzlich versicherte Patient:in muss einen Termin für eine psychotherapeutische Sprechstunde bei einem:einer kassenzugelassenen Therapeut:in vereinbaren. Dies kann über die Terminservicestelle 116117 erfolgen. Falls der:die Therapeut:in keinen freien Behandlungsplatz anbieten kann, soll sich der:die Patient:in dies explizit auf dem PTV 11-Formular vermerken.
Schritt 2: Kontaktaufnahme mit der Krankenkasse
Anschließend muss der:die Patient:in Kontakt mit seiner:ihrer Krankenkasse aufnehmen und die spezifischen Anforderungen für einen Antrag auf Kostenerstattung erfragen. An dieser Stelle dürfen sie sich nicht von pauschalen Ablehnungen oder Verweisen auf die Terminservicestelle abwimmeln lassen – sie haben einen Rechtsanspruch!
Schritt 3: Nachweis fehlender Therapieplätze
Nun muss der:die Patient:in – abhängig von der jeweiligen Krankenkasse – mindestens fünf vertragsärztlich zugelassene Psychotherapiepraxen kontaktieren und dabei systematisch dokumentieren:
- Name der Praxis
- Anrufdatum
- Frühestmöglichen Therapiebeginn (nicht Erstgesprächstermin!)
- Wartezeit bis zum Behandlungsbeginn
Schritt 4: Ärztliche Bescheinigungen einholen
Zudem benötigt der:die Patient:in von seiner:ihrer Hausarzt- oder Facharztpraxis:
- Notwendigkeits- oder Dringlichkeitsbescheinigung: Bestätigung der Behandlungsnotwendigkeit
- Konsiliarbericht: Bestätigung, dass keine körperliche Erkrankung gegen eine Psychotherapie spricht
Schritt 5: Bestätigung für einen Therapieplatz
Sie als Privatpraxis erstellen eine Bestätigung über einen zeitnahen Therapieplatz, den der:die Patient:in zusammen mit seinem:ihrem Antrag bei der Krankenkasse einreicht.
Schritt 6: Formlosen Antrag bei der Krankenkasse einreichen
Danach stellt der:die Patient:in einen formlosen, aber schriftlichen Antrag auf Bewilligung einer ambulanten Psychotherapie bei seiner:ihrer gewünschten Privatpraxis (also bei Ihnen). Dazu muss er:sie dem Antrag alle gesammelten Unterlagen, dokumentierten Nachweise und die Bestätigung über den zeitnahen Therapieplatz beifügen. Idealerweise gibt er:sie all das persönlich bei der Krankenkasse ab oder sendet die Unterlagen per Einschreiben. Die persönliche Übergabe ermöglicht allerdings die sofortige Klärung offener Fragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Wichtige Fristen und Rechte
Die Krankenkasse muss nun innerhalb von drei Wochen über den Antrag des:der Patient:in entscheiden. Wenn ein Gutachten eingeholt werden muss, verlängert sich die Frist auf fünf Wochen. Erfolgt aber keine rechtzeitige Mitteilung eines hinreichenden Grundes für eine Verzögerung, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt.
Bei einer Ablehnung des Antrags hat der:die Patient:in das Recht auf Widerspruch. Ist der Widerspruch erfolgt, hat die Krankenkasse drei Monate Zeit zur Entscheidung. Lässt sie diese Frist unbeantwortet verstreichen, hilft eine Nachfristsetzung und notfalls auch eine Untätigkeitsklage vor dem Sozialgericht.
Häufige Ablehnungsgründe und deren Rechtswidrigkeit
Viele Krankenkassen lehnen Anträge auf Kostenerstattung rechtswidrig ab. Häufig sind vor allem diese beiden Ablehnungsgründe:
- Ablehnung mit dem Verweis auf die Terminservicestellen – dies ist rechtlich unzulässig, da diese nur für Sprechstunden und Akutbehandlungen zuständig sind.
- Krankenkassen behaupten fälschlicherweise, die Kostenerstattung sei mit der neuen Psychotherapie-Richtlinie abgeschafft worden – dies entspricht nicht der Rechtslage.
Kostenerstattung und Honorar
Die gesetzliche Krankenkasse muss im Kostenerstattungsverfahren die gesamten Gebühren übernehmen, die für die Behandlung ihrer Versicherten in einer Privatpraxis anfallen. Einschränkungen auf »kassenübliche Sätze« sind rechtswidrig. Die Abrechnung erfolgt nach der Gebührenordnung für Psychotherapeuten (GOP), die auf der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) basiert. Genaue Informationen finden Sie als Psychotherapeut:in in unserem umfassenden Artikel zur Abrechnung.
Fazit
Das Kostenerstattungsverfahren bietet einen wichtigen Weg zur zeitnahen psychotherapeutischen Versorgung von gesetzlich versicherten Patient:innen, erfordert jedoch eine systematische Herangehensweise und Beharrlichkeit gegenüber den Krankenkassen. Für Psychotherapeut:innen ohne Kassensitz ist es wichtig, gesetzlich versicherte Patient:innen in Not über diese Möglichkeit informieren zu können und bei der Antragstellung zu unterstützen. Das Verfahren trägt dazu bei, die Versorgungslücke in der ambulanten Psychotherapie zu schließen und ermöglicht es qualifizierten Therapeut:innen ohne Kassensitz, ihre Expertise auch innerhalb des Kassensystems anzubieten.
Die konsequente Durchführung aller Schritte und die Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen erhöhen die Erfolgschancen erheblich. Patient:innen sollten sich nicht von initial ablehnenden Reaktionen der Krankenkassen entmutigen lassen, sondern ihr gesetzlich verbrieftes Recht auf angemessene psychotherapeutische Versorgung einfordern.
Praktische Checkliste für Patient:innen
Vor der Antragstellung:
☐ Psychotherapeutische Sprechstunde absolviert (PTV 11-Formular erhalten)
☐ Mindestens 5 Kassenpraxen kontaktiert und Absagen dokumentiert
☐ Notwendigkeitsbescheinigung von Hausarzt-/Facharztpraxis eingeholt
☐ Konsiliarbericht von Hausarzt-/Facharztpraxis eingeholt
☐ Spezifische Anforderungen der eigenen Krankenkasse erfragt
Antragstellung:
☐ Formloser schriftlicher Antrag verfasst
☐ Bestätigung über zeitnahen Therapieplatz von Privatpraxis erhalten
☐ Alle Unterlagen vollständig zusammengestellt
☐ Einreichung per Einschreiben oder persönliche Übergabe
Nach der Antragstellung:
☐ Bearbeitungsfristen im Blick behalten (3–5 Wochen)
☐ Bei Ablehnung: Widerspruch innerhalb der Frist einlegen
☐ Bei Untätigkeit der Krankenkasse: Nachfristsetzung und ggf. Untätigkeitsklage prüfen
Quellen
https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/fokus/psychotherapie.jsp
https://www.therapie.de/psyche/info/fragen/wichtigste-fragen/psychotherapie-kostenerstattung/
https://www.wsd-psychotherapie.de/ablauf-vorgehen-kostenerstattung/
https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/terminservice
https://praxisdrbeer.de/wissen/kostenerstattungsverfahren/
https://www.zensivo.de/gesetzlich-versicherte.php
http://psychotherapie-hegner.de/hilfestellungen-zum-kostenerstattungsverfahren/
https://kostenerstattung.de/index.php?page=635477752&f=1&i=635477752
https://storage.e.jimdo.com/file/c419cd2c-50bd-4e01-907b-df7e0462c6ee/5.%20Konsiliarbericht.pdf
http://psychotherapie-hegner.de/informationen-zum-kostenerstattungsverfahren/
https://www.pvs-reiss.de/magazin/patientenrechtegesetz-kostenerstattung/
https://www.pkv-institut.de/magazin/artikel/diese-fristen-fuer-leistungsantraege-muessen-sie-kennen
https://www.forum-verlag.com/fachwissen/gesundheitswesen-und-pflege/psychotherapie/
https://info.doctolib.de/blog/gebuhrenordnung-fur-psychotherapeuten/
https://live.consularia.de/wirksamkeit-der-online-gruppentherapie/
https://www.presseportal.de/pm/66044/5272764
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10063473/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11230946/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9183758/
http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845223308-327.pdf
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8632201/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11077551/
https://www.vdek.com/magazin/ausgaben/2023-04/analyse-wartezeiten-psychotherapie.html
https://www.psych-leipzig.de/honorar/kostenerstattung/
https://www.tymia.de/psychotherapeuten-finden/kostenerstattungsverfahren-in-der-psychotherapie/
https://link.springer.com/10.1007/s00103-024-03904-7
http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/a-1327-4431
http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/a-0601-0568
https://link.springer.com/10.1007/s41975-020-00146-z
https://link.springer.com/10.1007/s00103-023-03756-7
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10266895/
http://link.springer.com/10.1007/s00117-020-00679-1
https://www.kvbb.de/patienten/terminservicestelle
https://www.kvb.de/patienten/terminservice
https://zentrum-isartal.de/wp-content/uploads/2016/01/Information-fu%CC%88r-Patienten-.pdf
https://www.degruyter.com/document/doi/10.9785/gesr-2024-230606/html
https://www.therapie.de/fileadmin/dokumente/Presseartikel/therapiede_dossier_privatpraxis.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Pdf/Y-300-Z-BECKRS-B-2023-N-31711?all=False
https://live.consularia.de/abrechnung-von-videosprechstunden/
https://software-psychotherapie.de/psychotherapie-eigene-privatpraxis-gruenden-so-gehts/
https://www.dptv.de/im-fokus/gop/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11248752/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10994988/
http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0042-116421
http://link.springer.com/10.1007/s00278-017-0218-4
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9525140/
https://www.springermedizin.de/doi/10.1007/s12634-019-0039-2
https://link.springer.com/10.1007/s00350-023-6526-5

Bis 2006 war ich Führungskraft im Marketing eines internationalen Finanzvertriebs. Zwischen 2007 und 2023 war ich als Kommunikationsberater mit Schwerpunkt Online-Marketing und Social Media tätig. Außerdem bin ich Autor der beiden Fachbücher »Social-Media-Marketing für Dummies« und »Wirkungsvoll fürs Web texten für Dummies«, die im Buchhandel erhältlich sind. Seit Ende 2023 verstärke ich die Consularia GmbH als Leiter des Marketings.